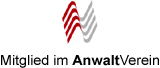Jeder Arzt ist verpflichtet, bei seiner Arbeit eine sachgerechte Versorgung des Patienten zu gewährleisten. Sachgerecht ist die Versorgung, wenn sie nach den Regeln der ärztlichen Kunst mit dem Ziel der Wiederherstellung der körperlichen oder gesundheitlichen Integrität erfolgt. Ein Behandlungsfehler liegt daher vor, wenn der Arzt den geforderten Qualitätsstandard unterschreitet.
Das Gericht entscheidet darüber, indem es das Gutachten eines medizinischen Sachverständigen einholt. Dieser legt seiner Prüfung den Sorgfaltsmaßstab zugrunde, der von dem jeweiligen ärztlichen Fachkreis, dem der Arzt entstammt, erwartet wird (Facharztstandard).
Um den jeweils geltenden Standard zu ermitteln, kann der Sachverständige auf die Leitlinien der Fachgesellschaften zurückgreifen. Diese Leitlinien werden gesammelt von der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) und können hier eingesehen werden. Eine laienverständliche Erläuterung einzelner Leitlinien haben die Bundesärztekammer und Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hier herausgegeben.
Die Leitlinien sind allerdings nur Beurteilungskriterien. Sie dienen in erster Linie den Ärzten zur Orientierung im Hinblick auf die vorzunehmenden Behandlungsschritte.
Ein grober Behandlungsfehler liegt vor, wenn das Fehlverhalten des Arztes aus medizinischer Sicht völlig unverständlich ist und einem Arzt einfach nicht unterlaufen darf. Dies wird bei einem Verhalten angenommen, das gegen eindeutig gesicherte medizinische Kenntnisse sowie bewährte ärztliche Behandlungsregeln und Erfahrungen verstößt.
Grobe Behandlungsfehler erleichtern im Prozess die Beweisführung für den Patienten. Nach den Grundsätzen des Zivilprozesses müsste der Patient beweisen, dass der Fehler des Arztes – und nicht ein anderer Umstand wie z.B. Stress, körperliche Schwäche – zu der Verschlechterung des Gesundheitszustandes geführt hat. Das wird dem Patienten auch unter Zuhilfenahme eines Experten regelmäßig sehr schwer fallen. Schuld daran ist die Unberechenbarkeit des menschlichen Organismus.
Bei einem groben Behandlungsfehler wird die Beweislast daher nach ständiger Rechtsprechung anders verteilt. Der Arzt muss beweisen, dass sein offensichtlicher Verstoß gegen ärztliche Behandlungsleitlinien nicht zu dem Gesundheitsschaden geführt hat, sondern dass hierfür die körperliche Verfassung des Patienten o.ä. verantwortlich war. Das wird wiederum dem Arzt bei einem schweren Verstoß gegen Behandlungsgrundsätze nur sehr selten gelingen.
Aus diesem Grund entscheidet die Beweislast, mit anderen Worten das Vorliegen eines groben Behandlungsfehlers, oftmals über Sieg oder Niederlage in einem Arzthaftungsprozess.
Klassischerweise entsteht der Behandlungsfehler in Form des Therapiefehlers oder durch die Wahl einer falschen Therapie. Er kann aber auch durch ein Übernahme- oder Organisationsverschulden entstehen. Darüber hinaus kann er in Form des Diagnosefehlers, durch die Nichterhebung diagnostischer Kontrollbefunde oder durch eine mangelhafte therapeutische Sicherungsaufklärung entstehen.
Der klassische Fall eines Behandlungsfehlers ist der Therapiefehler. Er liegt vor, wenn die Ausführung der Behandlungsmaßnahmen gegen anerkannte medizinische Soll-Standards verstößt. Das gilt auch dann, wenn erforderliche Behandlungsmaßnahmen unterlassen werden.
Die Behandlung entspricht nur dann den Regeln der Kunst, wenn konkret alles getan wird, was nach den Regeln und Erfahrungen der medizinischen Wissenschaft zur Bewahrung des Patienten vor körperlichen Schäden getan werden muss. Es genügt also nicht allein, wenn eine anerkannte Heilmethode gewählt wird, sie muss auch richtig angewendet werden.
Bei einem Therapieauswahlfehler wählt der Arzt die falsche Methode für die Behandlung einer Krankheit oder deren Diagnostik.
Eigentlich hat jeder Arzt das Recht, über die Form der Therapie frei zu entscheiden. Diese sogenannte Therapiefreiheit endet allerdings, wenn die gewählte Methode zur Behandlung völlig ungeeignet ist oder es eine Methode gibt, die bei weniger Risiken einen besseren Heilungserfolg verspricht.
Gibt es mehrere Methoden, die gleich Erfolg versprechend und risikoreich sind, aber unterschiedliche Risikoarten und Belastungen für den Patienten bedeuten, muss der Arzt den Patienten zwischen den in Betracht kommenden Methoden wählen lassen.
Ein Behandlungsfehler liegt auch dann vor, wenn ein Arzt die Behandlung eines Patienten übernimmt, obwohl er nicht in der Lage ist, den erforderlichen medizinischen Standard zu gewährleisten. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Arzt die Grenzen seines Fachgebietes überschreitet und den Facharztstandard nicht gewährleisten kann, oder wenn die technisch-apparative Ausstattung des Arztes nicht genügt. Genügen die Kenntnisse und Fertigkeiten des Arztes nicht, so verstößt er gegen seine Sorgfaltspflichten, wenn er keinen entsprechenden Spezialisten hinzuzieht.
Von einem Organisationsverschulden spricht man, wenn der Arzt oder die Krankenhausleitung die Pflicht, die Behandlung sachgerecht zu koordinieren und zu überwachen, verletzt.
Die Pflicht umfasst die Einhaltung der Hygienevorschriften, die Bereithaltung eines angemessenen medizinischen Vorrats, die Überwachung des Personals sowie die regelmäßige Wartung der medizinischen Apparate. Darüber hinaus müssen sogenannte Verkehrssicherungspflichten beachtet werden wie zum Beispiel die ordentliche Beleuchtung der Räumlichkeiten, die Vermeidung von Sturzgefahren sowie insbesondere der Schutz von Kindern und Suizidgefährdeten.
Dem Arzt unterläuft ein Diagnosefehler, wenn er eine Krankheitsbestimmung vornimmt, die medizinisch nicht vertretbar ist. Der „grobe“ Diagnosefehler wird fundamentaler Diagnosefehler genannt. Er liegt vor, wenn die Diagnose völlig unbrauchbar und unvertretbar ist.
Ein Befunderhebungsfehler liegt vor, wenn der Arzt erforderliche Diagnosebefunde oder Kontrollbefunde nicht erstellt. Der Arzt muss mittels der ersten Untersuchungen und Befunde seine Diagnose stellen. Dabei muss er die Befunde nicht nur bewerten (Diagnosefehler), sondern in einem angemessenem zeitlichen Umfang erforderliche weitere Befunde erheben (Befunderhebungsfehler), um den Verdacht einer Erkrankung zu erhärten oder auszuräumen.
Unter mehreren Untersuchungsmethoden muss der Arzt diejenige auswählen, die bei optimaler Effizienz die geringsten schädlichen Auswirkungen hat. Auch eine sog. Überdiagnostik, also die Vornahme nicht gebotener Untersuchungen, kann zu einem Behandlungsfehler führen.
Die Abgrenzung zwischen Diagnosefehler und Befunderhebungsfehler ist wichtig für die Beweislastverteilung. Für eine Umkehr der Beweislast zugunsten des Patienten reicht eventuell schon ein einfacher Befunderhebungsfehler. Handelt es sich bei dem Fehler des Arztes aber um einen Diagnosefehler, dann muss dieser "grob" bzw. funamental sein, damit der Patient in den Genuss einer Beweiserleichterung kommt.
Die Anforderungen an einen "groben"/fundamentalen Diagnosefehler sind aber sehr hoch, weil das Nichterkennen einer Erkrankung häufig nicht auf einem vorwerfbaren Verhalten des Arztes beruht, sondern die Symptome einer Erkrankung nicht eindeutig erkennbar sind. Anders ist das beim Befunderhebungsfehler: Er liegt vor, wenn der eine Arzt zweifelsfrei erforderliche Befunderhebung nicht vornimmt (z.B. Abtasten, Röntgen). Bereits einer "einfacher" Verstoß gegen diese Verhaltenspflicht kann zu Beweiserleichterungen führen, wenn sich später herausstellt, dass der Arzt bei dieser Untersuchung die Erkrankung sehr wahrscheinlich noch rechtzeitig erkannt hätte.
In der Praxis ist die Unterscheidung von Diagnosfehler und Befunderhebungsfehler daher sehr wichtig, sie bleibt aber oft schwierig. Erst kürzlich hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass ein Diagnosefehler nicht dadurch zu einem Befunderhebungsfehler wird, "dass bei objektiv zutreffender Diagnosestellung noch weitere Befunde zu erheben gewesen wären." (BGH, Urteil vom 21.12.2010, VI ZR 284/09)
Über die Bedeutung der Aufklärungspflicht im Rahmen der Arzthaftung existieren viele Mythen. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter dem Stichwort Aufklärungspflicht.
Bezogen auf Ihren Entschädigungsanspruch als Patient ist es besonders wichtig, die „therapeutische Sicherungsaufklärung“ von der Selbstbestimmungsaufklärung zu unterscheiden. Die Selbstbestimmungsaufklärung betrifft die Entscheidungsfreiheit des Patienten dahingehend, eine Behandlung vornehmen zu lassen oder nicht und erfordert das Aufzeigen möglicher Risiken oder Behandlungsalternativen durch den Arzt.
Die Verletzung der Selbstbestimmungsaufklärung allein, führt noch nicht zu einer Schadensersatzpflicht. „Denn eine ärztliche Heilbehandlung, die – mangels ausreichender Aufklärung – ohne wirksame Einwilligung des Patienten erfolgt, führt nur dann zur Haftung des Arztes, wenn sie einen Gesundheitsschaden des Patienten zur Folge hat“ (BGH, Urteil vom 27. 5. 2008 - VI ZR 69/07).
Die Sicherungsaufklärung meint die Pflicht des Arztes, dem Patienten Schutz- und Warnhinweise zu erteilen und über die erforderliche Mitwirkung an der Heilung zu informieren (z.B. regelmäßige Einnahme entzündungshemmender Medikamente).
Unterlässt der Arzt die therapeutische Sicherungsaufklärung, so liegt ein Behandlungsfehler vor, der zu einer Entschädigung führen kann. Es kann sich sogar um einen groben Behandlungsfehler handeln, mit der Folge einer deutlich günstigeren Beweissituation für den Patienten.
Wenn Sie einen Behandlungsfehler vermuten, sollten Sie die Krankengeschichte zunächst stichpunktartig in ihrer zeitlichen Abfolge schriftlich festhalten.
Daraufhin sollten Sie vom Arzt oder vom Krankenhaus sämtliche Behandlungsunterlagen herausverlangen. Sie haben einen Anspruch auf Einsicht in die Patientenunterlagen nach § 810 BGB. Er steht auch den Erben zu. Die Kosten für Kopien oder Transport müssen Sie zunächst auslegen, die Kosten können aber später als Schadensersatz zurück verlangt werden. Sollte Ihr Arzt sich weigern oder benötigen Sie anderweitig Unterstützung, fordern wir die Patientenakte gern für Sie von Ihrem Arzt an.
Außerdem ist es in diesem Stadium von immenser Bedeutung die Beweise für den vermuteten Behandlungsfehler zu sichern. Sie sollten also – wenn möglich – keine weitere ärztliche Behandlung vornehmen lassen ohne zuvor ein fachmedizinisches gerichtliches Gutachten zu Ihrem Gesundheitszustand eingeholt zu haben. Wir helfen Ihnen gern bei der Beauftragung eines geeigneten und schnellen Gutachters.
Können Behandlungsfehler und Gesundheitsschaden nachgewiesen werden, schließt sich die schriftliche Auseinandersetzung mit dem Arzt bzw. dessen Haftpflichtversicherung an, die zunächst auf eine außergerichtliche Einigung abzielt. Sollte keine Einigung erzielt werden, muss vor dem zuständigen Gericht geklagt werden.
Aspirin, Acetylsalicylsäure
Bandscheibenvorfall
Bypass-OP
Dammriss
Dekubitus, Druckgeschwür
Erblindung, Sehstörung
Fraktur, Knochenbruch
Herzinfarkt
Infektion
Krebs
Morbus Sudek
Optikusneuropathie (AION)
Prellung
Sterilisation
Weitere Informationen, die Sie im Zusammenhang mit dem Thema Arzthaftung - Behandlungsfehler interessieren könnten, finden Sie hier:
Kommentare unseres Anwaltsteams zu aktuellen Fragen rund um das Thema Arzthaftung - Behandlungsfehler finden Sie hier:
Krankenhausrecht aktuell: 11/009 Kontrollpflichten in einer Rehaklinik
Krankenhausrecht aktuell: 10/010 Zu Unrecht Krebs diagnostiziert
Krankenhausrecht aktuell: 10/008 Geburt trotz Sterilisation
Krankenhausrecht aktuell: 10/007 Sachgerechte Behandlung eines Dekubitus
Krankenhausrecht aktuell: 10/006 Dammriss: Falsche Naht führt zu Beschwerden
Krankenhausrecht aktuell: 10/005 Bruch statt Prellung
Krankenhausrecht aktuell: 10/004 Mangelnde Hygiene bei Injektion
Krankenhausrecht aktuell: 10/003 Neuartige Behandlung von Bandscheibenschäden
Krankenhausrecht aktuell: 10/002 Arzthaftung wegen unterlassener Befunderhebung
Krankenhausrecht aktuell: 09/006 Behandlungsfehler: Arzt zu Schadensersatz verurteilt
Unsere Büros können Sie von Montag bis Freitag, jeweils von 09:00 Uhr bis 20:00
Uhr, unter folgenden Anschriften in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg
und Stuttgart erreichen:
Letzte Überarbeitung: 6. Februar 2013